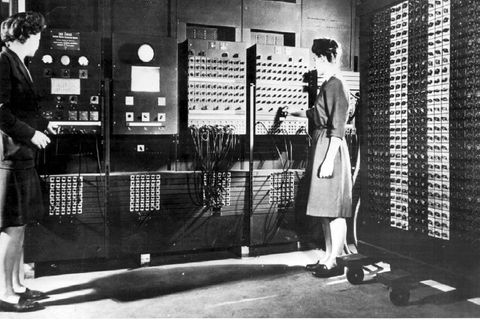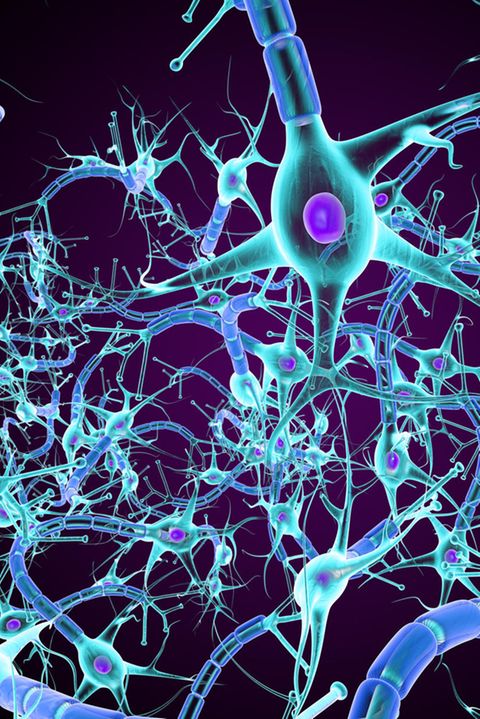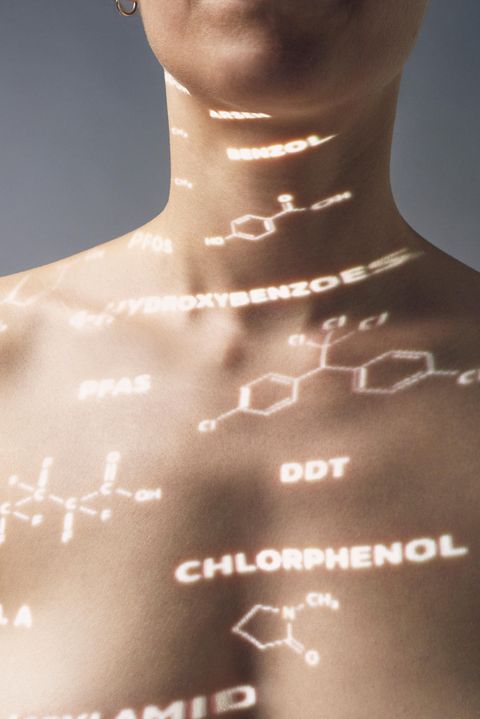Die Menschen drängen sich auf dem Platz vor dem Lincoln Memorial, dem Denkmal für den 16. US-Präsidenten und Vorkämpfer für die Befreiung der Schwarzen aus der Sklaverei. Zu Zehntausenden sind sie einem Aufruf zum "March on Washington for Jobs and Freedom" gefolgt, um an diesem Tag, dem 28. August 1963, für Arbeit und gleiche Rechte aller Bürger der USA zu demonstrieren.
Singend sind sie aus den Sonderzügen gestiegen, aus den Bussen. Ältere schwarze Männer im Sonntagszwirn.
Weiße Studenten in T-Shirts. Auch Bühnen- und Filmstars wie Josephine Baker, Marlon Brando, Burt Lancaster und Charlton Heston sind gekommen sowie viele Abgeordnete des US-Kongresses.
Eine Viertelmillion Menschen, Schwarze und Weiße, haben sich zur größten Demonstration versammelt, die Washington je erlebt hat.
Die Regierung und viele Bürger fürchten um Sicherheit und Ordnung. Der Verkauf von Alkohol ist an diesem strahlenden Augusttag verboten. 4000 Soldaten stehen in den Vororten bereit, 15 000 Fallschirmspringer können sofort in Bewegung gesetzt werden.
Doch die Demonstranten bleiben friedlich. Während die Luft immer schwüler wird; während Bob Dylan singt und Mahalia Jackson; während all der Reden, der Forderungen nach Freiheit.
Dann tritt der letzte Redner vor. Der Mann, auf den alle gewartet haben: Pastor Martin Luther King jr.
Der bedeutendste Anführer der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Ein charismatischer Redner, der von vielen als afroamerikanischer Moses verehrt wird, gleichzeitig aber ein heimlicher Sünder mit zahllosen Affären ist. Den die einen als gefährlichen Radikalen ablehnen und die anderen als harmlosen Onkel Tom. Der Prediger des gewaltfreien Widerstands, der ohne die brutalen Exzesse seiner Gegner nichts erreicht hätte.
Endlich setzt der zukünftige Märtyrer des schwarzen Amerikas, der von einem Angriff eine kreuzförmige Narbe über dem Herzen trägt, zu seiner Rede an. Einer Rede, die ihn unsterblich machen wird.
100 Jahre sind vergangen, seit Abraham Lincoln mit seiner "Emanzipationserklärung" begann, die Sklaven im Süden Amerikas zu befreien. Zuvor hatten sich elf Südstaaten, darunter Mississippi, Georgia, Alabama, von den USA abgespalten und 1861 als "Konföderierte Staaten von Amerika" zusammengeschlossen - aus Protest gegen die sklavereifeindliche Haltung vieler der 23 Nordstaaten. 19 von ihnen hatten bereits ihre Sklaven freigelassen.
Neun von zehn Afroamerikanern lebten als Sklaven
In dem darauf folgenden Bruderkrieg kämpfte eine Union dieser 19 Nordstaaten für die Einheit der USA - und ab 1863 auch für das Ende der Sklavenhaltung in den Südstaaten. Zwei Jahre später ging der Amerikanische Bürgerkrieg mit einem Sieg der Union über die Konföderierten zu Ende; mehr als 600 000 Menschen waren gefallen.
Mehrere Zusatzartikel zur Verfassung erklärten die Sklaverei anschließend in den gesamten USA für beendet.
Sie sicherten den Schwarzen Bürgerrechte zu und schrieben fest, dass niemand wegen seiner Hautfarbe von Wahlen ferngehalten werden dürfe.
Neun von zehn Afroamerikanern lebten zu jener Zeit als Sklaven auf den Plantagen der Südstaaten. Doch frei wurden sie nur nach dem Verfassungstext - tatsächlich aber blieben sie abhängig von den Familien, denen sie zuvor als Unfreie gedient hatten, verdingten sich als billige Arbeiter auf den gleichen Baumwollfeldern, auf denen sie zuvor schon geschuftet hatten.
Und die Südstaatler unterdrückten die Schwarzen weiterhin. Ungehindert vom Obersten Gerichtshof, erließen sie Gesetze, die fast jeden Kontakt zwischen Schwarz und Weiß verhinderten. Der Grundsatz "separate but equal", "getrennt, aber gleich", wurde zum rechtlichen Fundament der Rassentrennung.
Und weil die Verfassung nur verbot, Wähler wegen ihrer Hautfarbe zu diskriminieren, erfanden sie neue Hürden: etwa eine Wahlsteuer, einen Lesetest.
Millionen Schwarze haben die Südstaaten verlassen
Diese "Jim-Crow-Gesetze", benannt nach einem afroamerikanischen Charakter in rassistischen Musikshows, bestimmen das Leben der Schwarzen im Süden auch noch fast 100 Jahre später:
Ihre Kinder werden in Krankenhäusern für Schwarze geboren, gehen in Schulen für Schwarze, schaukeln auf Spiel- plätzen für Schwarze. Die Nachfahren der Sklaven dürfen im Süden nicht die gleichen Toiletten benutzen wie Weiße, nicht die gleichen Trinkbrunnen, nicht die gleichen Ankleideräume.
Sie dürfen ihren Kaffee nicht dort bestellen, wo die Weißen ihn trinken. Sie werden in anderen Bestattungsinstituten aufgebahrt, auf anderen Friedhöfen begraben, ihr Tod wird in einem anderen Teil der Zeitung bekannt gegeben. Ihre Schulen sind schlechter ausgestattet, und nur die Toiletten für Weiße unterscheiden zwischen "Damen" und "Herren".
Den Frauen verwehren Händler die höfliche Anrede "Mrs.", die Männer werden in jedem Alter "boy" genannt.
Das sind die Umstände, unter denen der am 15. Januar 1929 in Atlanta, Georgia, geborene Michael King jr. aufwächst.
Sein Vater und einer der Großväter sind Baptistenprediger, und nach einem Besuch in Europa gibt der Vater sich und seinem fünfjährigen Sohn den Vor- und Nachnamen des großen deutschen Reformators aus Wittenberg.
Martin Luther King jr. ist ein ausgezeichneter Schüler. Er will Anwalt werden oder Arzt. Doch am Morehouse College trifft er Theologen, die das Amt des Pastors als soziale Arbeit verstehen und anspruchsvolle Predigten halten. Und so folgt er doch dem Beispiel des Vaters.
Die erste Stelle als Pastor tritt er kurz nach seiner Hochzeit im September 1954 an: in der Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery, Alabama.
Die Zeiten sind schwer. Etwa vier Millionen Schwarze haben seit 1910 die Südstaaten verlassen und sind in die Industriestädte im Norden gezogen: Der Konflikt zwischen Schwarz und Weiß ist längst ein nationales Problem.
Doch kurz vor Kings erster Predigt in Montgomery hat das Verfassungsgericht der USA, der Supreme Court, mit einem Urteil den Rechtsgrundsatz "getrennt, aber gleich" infrage gestellt.
Es hat entschieden, dass es gegen die Verfassung verstößt, wenn ein schwarzes Mädchen täglich eine Meile mit dem Bus zu einer Schule für Schwarze fahren muss, statt die Grundschule für weiße Kinder in ihrer Nachbarschaft zu besuchen.
Vorangetrieben hat die Musterklage die "National Association for the Advancement of Colored People", eine schwarze Bürgerrechtsorganisation.
Sie setzt auf Veränderung durch Gesetze und Richtersprüche.
Weiße Schläger beleben den "Ku-Klux-Klan" wieder
Aber auch nach diesem Sieg vor dem Supreme Court ändert sich wenig in den Schulen des Südens.
Im Gegenteil: Weiße Schläger beleben den "Ku-Klux-Klan" wieder, einen rassistischen Geheimbund, der sich 1944 offiziell aufgelöst hat. Einige Staaten erlassen Gesetze gegen die Bürgerrechtsbewegung; so können Lehrer und Beamte ihre Stelle verlieren, wenn sie in der NAACP mitarbeiten.
80 Prozent der Weißen im Süden sind dagegen, dass ihre Kinder mit Schwarzen zur Schule gehen. Demonstranten stehen vor jenen Schulen, die Afroamerikaner zulassen. Sie beschimpfen Kinder als Nigger, schwenken eine schwarze Babypuppe in einem Sarg.
Auch in Montgomery, Alabama, ist nichts zu spüren von dem ersten Sieg gegen die Rassentrennung. Zum einen setzen die Südstaaten das Urteil des Supreme Court nur schleppend um, zum anderen halten sie an allen anderen Ungerechtigkeiten fest, gegen die noch keiner geklagt hat.
Und die Afroamerikaner in der Stadt Montgomery spüren, wann immer sie in einen Bus steigen: Die Montgomery City Line hat die vorderen Reihen für Weiße reserviert, die hinteren sind für Schwarze vorgesehen. Dazwischen liegen "neutrale" Reihen - hier dürfen Afroamerikaner sitzen, solange kein Weißer stehen muss.
Am 1. Dezember 1955 sitzt Rosa Parks auf einem dieser Plätze, eine NAACP-Aktivistin.
Die Näherin fährt nach einem schweren Arbeitstag nach Hause. Der Bus füllt sich, weiße Männer stehen im Gang. Der Fahrer befiehlt Parks aufzustehen.
Sie bleibt sitzen. Der Fahrer ruft die Polizei. Rosa Parks wird verhaftet.
Als die NAACP davon hört, überreden die Bürgerrechtler sie zu einer Musterklage.
Die soll das Busunternehmen zwingen, alle Fahrgäste gleich zu behandeln.
Rosa Parks, würdevoll, arbeitsam, verheiratet, ist das perfekte Gesicht für diesen Protest.
Der Widerstand wird von den Gemeinden unterstützt, Kirchen sind die Versammlungsorte. Damit der Kampf über den ersten Protest hinausgeht, braucht die NAACP die Unterstützung der schwarzen Geistlichen. Und einen Anführer, der das schwarze Montgomery vereinen kann: einen intelligenten, redegewandten Pastor. Sie finden ihn in Martin Luther King jr.
Rosa Parks wird am 5. Dezember 1955 wegen Verletzung der Rassentrennung verurteilt. Ihre afroamerikanischen Mitbürger boykottieren daraufhin die Busse. Sie gehen zu Fuß, benutzen Sammeltaxis.
Mehr als 150 Schwarze stellen ihre Autos zur Verfügung.
Anfang Januar 1956, knapp zwei Monate nach dem Urteil, wird King verhaftet - angeblich ist er zu schnell gefahren.
Kurz darauf zerfetzt eine Bombe die Veranda seines Hauses, Glas splittert, Rauch dringt in die Wohnräume. King spricht gerade auf einer Kundgebung, seine Frau und ihr Baby bleiben unverletzt.
Als sich bewaffnete schwarze Demonstranten und Polizisten an diesem Abend vor seinem Haus gegenüberstehen, findet King Worte, die den Weg der Bürgerrechtsbewegung vorzeichnen.
"Legt eure Waffen weg", sagt er, "wir wollen unsere Feinde lieben. Wir müssen unsere weißen Brüder lieben, egal, was sie uns antun." Bereits im College hat Martin Luther King die Schriften von Mahatma Gandhi gelesen und die des amerikanischen Philosophen Henry David Thoreau über zivilen Ungehorsam. Er hat ihre Gedanken mit der Bergpredigt verbunden und in seinen Reden von Gewaltfreiheit gesprochen.
Jetzt beweist er, dass er seine Worte ernst meint.
Kennedy muss die Schwarzen für sich gewinnen
Sein Vater aber ist weniger überzeugt.
"Bist du Gandhi?", fragt er den Sohn, "die Briten haben ihn ins Gefängnis geworfen. Die Leute aus Alabama und Mississippi werden dich totschießen." Doch King lässt sich nicht abhalten.
Der Montgomery City Line fehlen durch den Boykott drei Viertel ihrer Kunden.
Als die Stadt wegen Geschäftsbehinderung Haftbefehl gegen King und 100 weitere Boykotteure erwirkt, geht der Pastor ins Gefängnis, umjubelt von seinen Anhängern. Zeitungen drucken die Fotos. Er ist zum Symbol der Bewegung geworden.
Und Mitte November 1956 entscheidet der Supreme Court, dass die Trennung von Schwarz und Weiß in Montgomerys Bussen nicht zulässig ist. Gut einen Monat später heben die Verkehrsbetriebe der Stadt die Rassentrennung nach 382 Tagen des Boykotts auf.
Dutzende schwarze Gemeinden im Süden nehmen sich ein Beispiel an Montgomery. King gründet mit anderen Aktivisten eine neue Organisation, die "Southern Christian Leadership Conference", um den Kampf lokaler Bürgerrechtsorganisationen in den Südstaaten zu koordinieren. Die Mitglieder wählen ihn zum Präsidenten.
Kings Reden, diese Kombination aus Predigt und Kampfansage, inspirieren eine Generation junger Schwarzer, vor allem Studenten. Überall im Süden beginnen sie im Frühjahr 1960 mit "Sitins":
Sie setzen sich an Tresen, an denen nur Weiße bedient werden, bleiben einige Stunden und kommen täglich wieder - oft wochenlang.
Gäste bewerfen sie mit Pommes frites und Kaugummis, drücken Zigaretten auf ihren Rücken aus. Die Polizei verhaftet die friedlich Protestierenden wegen Hausfriedensbruchs. Die Studenten wehren sich nicht.
Von Trainern einer Bürgerrechtsorganisation lernen sie Sicherheitsmaßnahmen:
"Um den Schädel zu schützen, faltet die Hände über dem Kopf. Um eine Entstellung des Gesichts zu verhindern, presst die Ellbogen vor den Augen zusammen. Für Mädchen, um innere Verletzungen durch Tritte zu verhindern, legt euch auf die Seite und zieht die Knie zum Kinn hoch; für Jungs, kniet euch hin und krümmt euch zusammen, schützt dabei Gesicht und Schädel." Zehntausende beteiligen sich, auch Martin Luther King. Er ist umhergereist, um Geld und Unterstützer zu werben.
Doch einen ähnlichen Erfolg wie den Montgomery-Boykott hat er noch nicht wieder erzielt. Jetzt ist er begeistert von den Studenten, lobt deren Mut und setzt sich mit ihnen an "weiße" Tresen.
Immer wieder macht die Bewegung Schlagzeilen. Auch 1960, im Jahr der Präsidentschaftswahl. "Es gehört zur amerikanischen Tradition, für seine Rechte aufzustehen", sagt John F. Kennedy, "auch wenn man sich neuerdings dazu hinsetzen muss." Der Demokrat muss die Schwarzen für sich gewinnen.
Zuletzt haben viele Nachfahren der Sklaven für die Republikaner gestimmt, die Partei Abraham Lincolns.
Nach Kennedys Amtsantritt im Januar 1961 aber zeigt sich, dass die Diskriminierungen im Süden den Millionärssohn aus Massachusetts nur wenig beschäftigen. Gleich in der ersten Woche seiner Präsidentschaft beschweren sich afrikanische Diplomaten, dass sie auf Autofahrten in den Restaurants am Weg nicht bedient werden.
"Kannst du ihnen nicht sagen, das nicht zu tun?", fragt Kennedy seinen Protokollchef. Dieser beginnt eine Erklärung, er versuche ja bereits, die Restaurantbesitzer zu überzeugen.
Da unterbricht ihn der Präsident und sagt: "Das meine ich nicht. Kannst du ihnen nicht einfach sagen, dass sie fliegen sollen?" Kennedy sorgt sich bereits um seine Wiederwahl: Er ist auf das Wohlwollen seiner Parteikollegen aus dem Süden angewiesen, und viele von denen halten wenig von den Versprechen, die er den Schwarzen im Wahlkampf gegeben hat.
Um sie zu versöhnen, ernennt er bekannte Befürworter der Rassentrennung zu Richtern - auf Lebenszeit. Und obwohl er im Wahlkampf versprochen hat, im staatlichen Wohnungsbau könne die Diskriminierung rasch aufgehoben werden, tut er nichts.
Die Bürgerrechtler fühlen sich verraten und planen neue Aktionen. Diesmal wollen sie als freedom riders mit einer "Fahrt für die Freiheit" auf gesetzeswidrige Rassendiskriminierung im Fernreiseverkehr aufmerksam machen und den Präsidenten so unter Druck setzen.
Sie fahren von Washington aus per Bus in das Herz des Südens - dorthin, wo gewaltloser Widerstand das Leben kosten kann.
Martin Luther King initiiert einen "Kinderkreuzzug"
Bereits in North Carolina kommt es zu ersten Rangeleien. In Anniston, Alabama, zünden Rassisten einen der Busse an, in denen die Freedom Riders reisen. In Birmingham wartet der Ku-Klux-Klan. Der Polizeichef hat den Klansmännern versprochen, sie 15 Minuten lang ohne Eingreifen gewähren zu lassen - und dafür verlangt, die Bürgerrechtler sollten hinterher aussehen, "als hätte eine Bulldogge sie erwischt".
So meldet es ein Informant dem FBI.
Die Schläger des Klans prügeln die Bürgerrechtler mit Stahlrohren halb tot, greifen auch Reporter an und zertrümmern deren Kameras.
Während die Freedom Riders ihre Fahrt fortsetzen und King nach Alabama eilt, um sie zu unterstützen, arbeiten Kennedy und sein Bruder Robert, der Justizminister, hinter den Kulissen.
Einerseits können sie nicht dulden, dass Gesetze offen gebrochen werden, andererseits halten sie die Aktionen der Bürgerrechtler für zu radikal.
Der Wandel werde kommen, glauben die Kennedys, aber langsam. Er könne nicht erzwungen werden.
Zwar schicken sie Bundesbeamte nach Alabama, um die Bürgerrechtler zu schützen. Mit dem Senator von Mississippi aber, dem nächsten Ziel der Fahrt, schließen sie einen Pakt: Er soll dafür sorgen, dass die Freedom Riders nicht verprügelt werden - umgekehrt wird Washington nicht protestieren, wenn die Polizei Demonstranten verhaftet.
Sie sollten sich eine Zeitlang abkühlen, drängt Robert Kennedy die schwarzen Anführer: Sein Bruder stehe kurz vor einem Gespräch mit dem KP-Chef Nikita Chruschtschow, und die sowjetische Presse werde die Bilder aus den Südstaaten ausschlachten. Sei ihnen denn nicht klar, wie sehr das den Präsidenten in Verlegenheit bringen könne?
"Wir kühlen uns seit 100 Jahren ab", entgegnet einer der Bürgerrechtler, "wenn wir noch kühler werden, sind wir tiefgefroren." Viel wichtiger als ihre Aktionen sei doch die Registrierung von Wählern zur Gouverneurswahl 1963 in Alabama, sagt Robert Kennedy. Denn in den USA darf nur wählen, wer sich ins Wählerverzeichnis eintragen lässt. Und das ist für Afroamerikaner in vielen ländlichen Regionen der Südstaaten fast unmöglich.
Dorthin entsenden Bürgerrechtsorganisationen nun Teams, um den Schwarzen zu ihrem Wahlrecht zu verhelfen.
Auch diese Freiwilligen werden bedroht, zusammengeschlagen, verhaftet.
Es gibt Bombenanschläge. Und Tote.
Die versprochene Hilfe aus Washington aber bleibt aus.
Daraus zieht Martin Luther King einen Schluss: Präsident Kennedy wird seine Wahlversprechen nur dann wahr machen, wenn ihn die öffentliche Meinung dazu zwingt.
King will Gewalt deshalb nicht mehr nur in Kauf nehmen - sondern sie provozieren.
Er will brutale Bilder in die Wohnzimmer tragen. Dazu braucht er einen rücksichtslosen Gegner.
Seine Wahl fällt auf Birmingham. In keiner anderen US-Großstadt leben die Rassen so konsequent getrennt. Die Verwaltung hält Parks und Spielplätze lieber geschlossen, als sie für Schwarze zu öffnen. 1957 haben Ku-Klux-Klan-Männer einen Schwarzen kastriert - weil "Niggerkids nicht mit Weißen zur Schule gehen sollen", wie einer sagt.
Und der rassistische Polizeichef Eugene Connor hat einst die Freedom Riders dem Mob ausgeliefert.
Martin Luther Kings Kampagne beginnt im April 1963 mit Sit-ins. Die Teilnehmer werden festgenommen.
Geduldig schürt King das Interesse der Medien: Täglich lässt er kleine Gruppen demonstrieren, täglich werden sie verhaftet, vor den Augen der Kamerateams und Zeitungsreporter.
Die Stadtverwaltung erwirkt einen Gerichtsbeschluss gegen die Demonstrationen.
King marschiert trotzdem, mit 50 singenden Freiwilligen. Polizeichef Connor lässt ihn festnehmen.
In seiner Gefängniszelle schreibt King seinen vielleicht wichtigsten Text, auf den Rändern einer Zeitung und auf hereingeschmuggelten Papierfetzen.
Sein "Brief aus dem Gefängnis von Birmingham" richtet sich formal an acht Geistliche, die sich gegen seine Aktionen gewandt haben. Tatsächlich aber spricht er zu all jenen Menschen, die keine Rassisten sind, denen der gewaltlose Widerstand aber zu radikal ist.
"Wir haben mehr als 340 Jahre lang auf unsere verfassungsmäßigen und gottgegebenen Rechte gewartet", schreibt King.
Und fährt fort: "Wie mit Düsenantrieb rasen die Nationen Asiens und Afrikas auf das Ziel politischer Unabhängigkeit zu, und wir schleichen noch immer im Kutschentempo darauf zu, eine Tasse Kaffee in einem Imbiss trinken zu dürfen. Es ist einfach für jene, die nie die stechenden Pfeile der Rassentrennung gespürt haben, zu sagen: ‚Wartet.'" Der Brief wird als Broschüre in Kirchen verteilt. Zeitungen veröffentlichen Auszüge - und richten so die nationale Aufmerksamkeit auf Birmingham. King zahlt eine Kaution, um aus dem Gefängnis entlassen zu werden und die Konfrontation in Freiheit weiterzutreiben.
Doch die Proteste verlieren an Schwung. Es gibt kaum noch Erwachsene, die demonstrieren wollen.
Deshalb initiiert King einen "Kinderkreuzzug".
Mehr als 1000 Jugendliche und Kinder, manche erst sechs Jahre alt, verlassen am 2. Mai 1963 die Baptistenkirche in der 16th Street von Birmingham. Sie singen Freiheitslieder, knien nieder und beten. Polizeichef Connor lässt Hunderte verhaften.
Am Tag darauf versammeln sich erneut 1000 Kinder in der Kirche. Connor lässt die Eingänge blockieren. Doch die Hälfte der jungen Demonstranten entkommt.
Nun gibt der Polizeichef den Befehl zum Angriff.
Und die Nation sieht in den Abendnachrichten Polizeihunde, die Demonstranten beißen.
Sieht kleine Mädchen, die von Wasserwerfern die Straße hinuntergespült werden und denen der Wasserdruck die Kleidung von den Körpern fetzt. Sieht weiße Polizisten, die schwarze Demon stranten zusammenschlagen. So geht es über Tage. Nun hat Martin Luther King die Bilder, die er braucht.
Civil Rights Act: "Perfekte Blaupause für den totalitären Staat"
Zorn ergreift das schwarze Amerika - und Scham Millionen Weiße. Nach weiteren Unruhen in Alabama handelt Präsident Kennedy endlich.
In einer Fernsehansprache am 11. Juni beklagt er das Rassenproblem so deutlich wie nie zuvor: "Diese Nation wird nicht vollkommen frei sein, bis nicht alle ihre Bürger frei sind. Es ist Zeit, zu handeln, im Kongress, in den Bundesstaaten und Gemeinden, und, vor allem, in unserem täglichen Zusammenleben." Eine Woche später bittet der Präsident den Kongress, den Civil Rights Act zu verabschieden - ein Gesetz, das Unerhörtes vorsieht: Es hebt alle Privilegien der Weißen in Kinos, Restaurants, Hotels und anderen öffentlichen Gebäuden auf, autorisiert den Justizminister, Eltern, die gegen segregierte Schulen klagen, im Namen der Vereinigten Staaten vor Gericht zu vertreten, und schafft die Möglichkeit, Fördergelder einzufrieren für Programme, die diskriminieren.
James Eastland, der offen rassistische Senator von Mississippi, nennt den Gesetzesentwurf "eine perfekte Blaupause für den totalitären Staat". Über das neue Bürgerrechtsgesetz muss im Kongress abgestimmt werden.
Für seine Verabschiedung braucht Kennedy die Stimmen von 25 Senatoren aus den eigenen Reihen: von Politikern, die sich noch nicht festgelegt haben, wie sie stimmen werden - oder sogar gegen das Bürgerrechtsgesetz sind.
Zudem bleibt den Gegnern noch immer die Methode des Filibusters: Dabei redet ein Senator ununterbrochen zu einem beliebigen Thema und verhindert so, dass über ein Gesetz abgestimmt wird. Mit dieser Taktik haben die Südstaatenvertreter seit dem Zweiten Weltkrieg jedes Gesetz zu den Bürgerrechten verhindert.
Während Kennedy sein Civil Rights Act dem Kongress vorlegt, planen die Organisationen der Bürgerrechtsbewegung einen "Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit". Schwarze und Weiße sollen gemeinsam dafür demonstrieren, dass das Gesetz in Kraft tritt.
Noch aber hofft Kennedy, den Marsch verhindern zu können. Er fürchtet eine Massendemonstration in diesem aufgeheizten Sommer nach Birmingham - und eine Trotzreaktion der Senatoren.
"Wir wollen Erfolg im Kongress, nicht nur eine große Show vor dem Kapitol", sagt er bei einem Treffen mit King.
Doch die Anführer der Bewegung bleiben hart - und setzen den Termin für den Marsch fest.
Washington, 28. August 1963. Zwei Mitarbeiter Kennedys stehen bereit, um notfalls den Stecker des Mikrofons zu ziehen. Dann tritt Martin Luther King vor die Statue Abraham Lincolns.
"Die Zeit ist gekommen, aus dem dunklen und trostlosen Tal der Rassentrennung auf den sonnenbeschienenen Pfad der Gerechtigkeit aufzusteigen", sagt der Prediger unter tosendem Applaus.
Bis in die Nacht hinein hat er an seiner Rede geschrieben.
Nun aber ruft ihm Mahalia Jackson zu: "Erzähl ihnen von deinem Traum!" Und King lässt sich mitreißen, vergisst sein Manuskript und spricht frei.
"Ich habe einen Traum", sagt er in seinem tönenden Bariton, geübt in unzähligen Predigten, "dass eines Tages die Söhne ehemaliger Sklaven und die Söhne ehemaliger Sklavenhalter zusammen am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können.
Ich habe einen Traum, dass eines Tages, genau dort in Alabama, kleine schwarze Jungs und schwarze Mädchen die Hände kleiner weißer Jungs und Mädchen fassen können als Brüder und Schwestern." Es ist ein unerhörter Traum, den King da träumt, er zielt tief in das Herz jedes Rassisten, der nichts so sehr fürchtet wie die Vermischung von Schwarz und Weiß.
King zitiert die Bibel und die patriotische Hymne "My Country 'Tis of Thee" ("Mein Land, von Dir ist es").
Er träumt, dass eines Tages die Freiheit läuten wird von allen Hügeln und Bergen, auch vom Stone Mountain in Georgia, dem Stützpunkt des Ku-Klux- Klans, und vom Lookout Mountain in Tennessee, einer ehemaligen Festung der Konföderierten.
Die Menschen bejubeln Kings Rede.
Sie wird live auf drei nationalen Fernsehsendern übertragen, via Satellit sogar nach Europa - und sie versöhnt viele Weiße mit dem Freiheitskampf der Schwarzen.
Hier steht kein Agitator, der sich an den Enkeln der Sklavenhalter rächen will. Sondern ein Mann, der sich nichts anderes wünscht als ein menschenwürdiges Leben für seine Kinder.
Für den Vizedirektor des FBI aber beweist diese "demagogische Rede, dass King der effektivste und gefährlichste Anführer der Neger im Land ist".
Seit Jahren schon überwacht die Bundespolizei Martin Luther King, weil sie befürchtet, die Bürgerrechtsbewegung könne von Kommunisten unterwandert werden. Nun verschärfen die Beamten ihre Überwachung.
Mit 15 Mikrofonen belauschen sie heimlich den Pastor. "Kommunistische Umtriebe" können sie ihm ebenso wenig nachweisen wie Steuerhinterziehung.
Doch sie hören anderes.
Denn King betrügt seine Frau. Mit Groupies, die ihm ins Hotel folgen, mit Prostituierten.
Das FBI hört mit.
Dessen Direktor J. Edgar Hoover kommentiert persönlich die Abhörprotokolle.
Seit den 1950er Jahren lässt er alle Gruppen infiltrieren, die seiner Ansicht nach die USA zerstören könnten:
Kommunisten, Sozialisten, Bürgerrechtsorganisationen.
Er legt Akten mit belastendem Material über Politiker und andere wichtige Personen an - auch über Kennedy.
Der Marsch der Schwarzen auf Washington erschreckt den Rassisten Hoover. Aber er hat noch andere Gründe:
Der FBI-Direktor lässt Kings Liebesleben wahrscheinlich auch ausspionieren, weil er ein Voyeur ist, wie Historiker vermuten - fasziniert insbesondere von abweichendem Sexualverhalten, Ehebruch, Homosexualität.
Sein Stellvertreter dagegen ist angewidert.
Dem puritanischen William Sullivan fällt es schwer, über Kings Affären auch nur unter Kollegen zu sprechen.
Er kann nicht glauben, dass ein derart sündiger Mann ein integrer Anführer sein soll. Sullivan will King vernichten.
Seine Leute spielen Journalisten Dossiers über dessen Affären zu; den großen seriösen Tageszeitungen indes sind die amourösen Abenteuer des Pastors nicht einmal eine Meldung wert.
FBI-Agenten informieren sogar einen Kardinal über Kings außereheliches Liebesleben, um so eine Audienz im Vatikan zu verhindern - dennoch empfängt der Papst den Bürgerrechtler.
Denn das Oberhaupt der katholischen Kirche schätzt dessen Einsatz für die Gleichberechtigung der Schwarzen.
Schließlich lässt Sullivan Ende 1964 eine Aufnahme mit einschlägigen Passagen aus den Abhörbändern zusammenschneiden und an King schicken - versehen mit dem Begleitschreiben eines angeblichen Afroamerikaners, der King zum Suizid auffordert.
Doch der kann das Päckchen gar nicht entgegennehmen, weil er in Oslo gerade mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird. Als er die Aufnahmen schließlich erhält, glaubt er zu wissen, wer dahintersteckt.
"Die wollen mich zerbrechen", sagt er zu Freunden. Zwei seiner Mitarbeiter sprechen beim FBI vor, erfolglos. Erst gut ein Jahr später schalten die Agenten ihre Mikrofone ab - aus Angst vor einer Untersuchung durch den Senat.
"Black Power" wird zu einem Schlachtruf
John F. Kennedy wird ermordet, noch ehe der Civil Rights Act verabschiedet werden kann. Doch unter seinem Nachfolger Lyndon B. Johnson passiert das Gesetz den Kongress, auch aus Respekt vor dem toten Präsidenten.
1965 bringt Johnson für seine Vision einer "Großen Gesellschaft" ein Reformprogramm mit mehr als 60 Einzelmaßnahmen durch den Kongress, darunter eine staatliche Gesundheitsfürsorge sowie ein Gesetz, das schwarzen Wählern ermöglicht, sich ungehindert registrieren zu lassen. Auch ein Erfolg des gewaltlosen Widerstands.
Doch Kings friedliche Bewegung hat mit dem Marsch auf Washington ihren Höhepunkt erreicht. Die Wirklichkeit erschüttert schon bald den Traum des Predigers: Wenige Wochen nach seiner Rede wirft der Ku-Klux-Klan eine Bombe auf eine Kirche in Birmingham und tötet vier schwarze Mädchen.
Bis zum Sommer des Jahres 1964 sprengen weiße Fanatiker im Süden mindestens 30 Häuser, brennen 35 Kirchen nieder, verprügeln 80 Bürgerrechtler, schießen auf 30, bringen mindestens sechs um.
FBI-Direktor Hoover erklärt dazu, seine Behörde sei nicht dazu da, Studenten in Mississippi die Windeln zu wechseln.
Und so sind es viele Schwarze leid, die andere Wange hinzuhalten.
"Black Power" wird nun zu einem Schlachtruf, und viele stimmen dem Aktivisten Malcolm X zu, der den Marsch im August 1963 die "Farce von Washington" genannt hat.
Der Muslim, der seinen "Sklavennamen" Little gegen ein X getauscht hat, um seinen verlorengegangenen afrikanischen Namen zu symbolisieren, vertritt einen schwarzen Nationalismus. Er will nicht gemeinsam mit Weißen kämpfen, sondern gegen sie.
Auch Martin Luther King ist nicht mehr der versöhnliche Redner, der die Bürger Amerikas für seine Sache gewinnen kann. Er verliert in den Jahren nach dem Marsch auf Washington viele weiße Unterstützer - denn er wendet sich gegen den Krieg in Vietnam, während die meisten Amerikaner den Kampfeinsatz ihrer Soldaten in Südostasien noch unterstützen.
"Das Versprechen der ‚Großen Gesellschaft' ist niedergeschossen worden auf dem Schlachtfeld von Vietnam", erklärt King und verdirbt es sich deshalb mit der Regierung Johnson.
Er verliert Freunde in den eigenen Reihen, wird in den Augen der Liberalen zum Radikalen - und wird von den wahren Radikalen als immer noch zu weich verachtet.
Doch Präsident Johnson muss schließlich einräumen, dass er wegen der enormen Kriegskosten für seine gesellschaftspolitischen Ziele "nicht alles tun kann, was er tun sollte".
Und so klagt King immer lauter über die Tatenlosigkeit der Regierung:
"Ich habe versucht, zur Nation von meinem Traum zu sprechen", sagt er, "aber ich habe zugesehen, wie sich dieser Traum in einen Albtraum verwandelte, als ich durch die Ghettos des Landes wanderte und meine schwarzen Brüder und Schwestern vergehen sah auf einer einsamen Insel der Armut in der Mitte eines gewaltigen Ozeans materiellen Reichtums." Denn nicht nur in den Südstaaten leben Afroamerikaner in von den Weißen getrennten Quartieren, auch im Norden wohnen die meisten in ärmlichen Stadtteilen - mit unzureichender medizinischer Versorgung, schlechten Schulen, geringen Chancen zum sozialen Aufstieg.
In Harlem etwa, dem New Yorker Schwarzenviertel, sind doppelt so viele Menschen ohne Arbeit wie im Durchschnitt der anderen Stadtteile. Etwa die Hälfte der Jugendlichen verlässt die Highschool ohne Abschluss, qualifiziert allenfalls für Hilfsarbeiten.
Auch deshalb beträgt das Einkommen schwarzer Familien kaum 60 Prozent des Verdienstes weißer Haushalte.
Anfang April 1968 reist Martin Luther King nach Memphis in Tennessee, um dort streikende Müllmänner zu unterstützen.
Zu dieser Zeit hat das FBI bereits von 50 Attentatsplänen auf ihn erfahren und weiß, dass bis zu 100 000 Dollar auf seinen Kopf ausgesetzt sind.
Am 3. April spricht King in einer Kirche.
Er erzählt von Morddrohungen, die er nun immer häufiger erhält: "Es macht mir nichts aus. Denn ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Und ich habe das gelobte Land gesehen. Ich komme vielleicht nicht mit euch dorthin, aber wir als ein Volk werden es erreichen." Am Abend des nächsten Tages steht King auf dem Balkon seines Zimmers im "Lorraine Motel", frisch rasiert für ein Abendessen. Unten wartet eine Limousine auf ihn.
Da hallt ein Schuss über den Hof.
Eine Kugel - abgefeuert aus einem gegenübergelegenen Fenster - streift den Kiefer des 39-jährigen Pastors, dringt in dessen Hals ein, verletzt das Rückenmark.
King wird in eine Klinik gebracht, wo er eine Stunde später stirbt.
In einem Bündel vor einem Geschäft in Memphis findet die Polizei ein Gewehr, ein Fernglas, eine Zeitung, eine Flasche Aftershave und eine Dose Bier. Sie alle tragen die gleichen Fingerabdrücke.
Doch den Täter fasst Scotland Yard erst zwei Monate später auf dem Londoner Flughafen, kurz vor der Abreise in das rassengetrennte Rhodesien: Es ist James Earl Ray, ein weißer Rassist und Kleinkrimineller. Möglicherweise handelte er allein, um das Kopfgeld zu kassieren. Er gesteht die Tat und wird deshalb nicht zum Tode, sondern zu 99 Jahren Haft verurteilt.
Doch die Hintergründe des Mordes bleiben im Dunkeln. Zwar werden nie Hintermänner gefunden, doch passen Rays geringe Bildung und mangelndes kriminelles Geschick nicht zu seinem präzisen Plan, den gefälschten Pässen und einer fast geglückten Flucht nach Rhodesien. Eine Jury wird 1999 in einem von Kings Familie angestrengten Prozess feststellen, dass King Opfer unbekannter Verschwörer wurde.
Mit King stirbt der Traum der Afroamerikaner vom friedlichen Widerstand.
Die Nachricht von seinem Tod löst Unruhen in mehr als 100 Städten aus. In Chicago stehen Wohnblöcke in Flammen, in Washington beziehen Soldaten in Kampfmontur Stellung rund um Kapitol und Weißes Haus. Bei tagelangen Krawallen sterben Dutzende Menschen, mehr als 3000 werden verletzt, 27 000 festgenommen.
Mehr als 100 000 Menschen geleiten King in seiner Heimatstadt Atlanta zu Grabe. Das schwarze Amerika hat seinen Märtyrer. Seine Rede vor dem Lincoln Memorial wird in Lesebücher aufgenommen und als Nachdruck vertrieben.
Durch die Gesetze, die er erkämpft hat, steigt die Zahl der schwarzen Wähler allein in Mississippi, jenem Staat, der laut King "unter der Hitze der Unterdrückung vergeht", von sieben Prozent 1964 auf 59 Prozent 1968.
In den Jahren darauf werden in den USA immer mehr Schwarze in öffentliche Ämter gewählt: als Sheriff, Richter, Abgeordneter, Minister.
Und 46 Jahre nach dem Marsch auf Washington legt am 20. Januar 2009 erstmals ein Afroamerikaner den Amtseid als US-Präsident ab: auf den Stufen des Kapitols gegenüber dem Lincoln Memorial.
Nur gut drei Kilometer entfernt von jenem Ort, an dem Martin Luther King am 23. August 1963 seinen Traum mit Amerika teilte.
War Kennedy ein guter Präsident? Oder nur ein guter Präsidentendarsteller? Lesen Sie hier eine Bilanz seiner Amtszeit